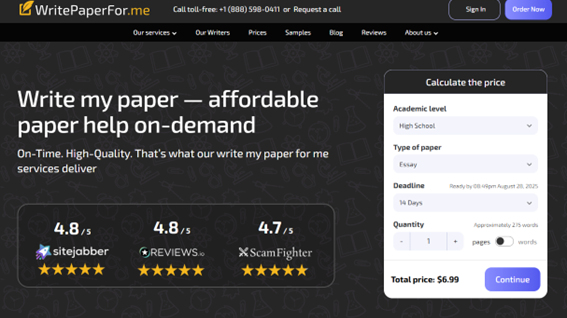Mit dem zunehmenden Einzug der KI in alle Bereiche der Gesellschaft entsteht ein neues Problem für die psychische Gesundheit: Die KI-Psychose.
Dieses Phänomen ist gekennzeichnet durch verzerrte Gedanken, Paranoia oder Wahnvorstellungen, die durch Interaktionen mit KI-Chatbots ausgelöst werden. Experten warnen, dass die Auswirkungen gravierend sein können - sie reichen von sozialem Rückzug und schlechter Selbstfürsorge bis hin zu verstärkter Angst.
Um dieses Konzept näher zu beleuchten, hat Dr. David McLaughlan, beratender Psychiater am Priory und Mitbegründer von Curb Health, erklärt, was KI-Psychose eigentlich ist, was die Warnzeichen einer ungesunden Beziehung zu KI sind und wann es an der Zeit ist, professionelle Hilfe zu suchen.
Was ist eine KI-Psychose?
"Eine Psychose ist ein Zustand, in dem jemand den Bezug zur Realität verliert", erklärt McLaughlan. "Sie geht oft mit Halluzinationen einher, z. B. dem Hören von Stimmen oder dem Sehen von Dingen, die nicht da sind, sowie mit Wahnvorstellungen, d. h. festen Überzeugungen, die nicht mit den Fakten übereinstimmen.
"Für die Person, die eine Psychose erlebt, fühlen sich diese Wahrnehmungen absolut real an, auch wenn andere sie nicht teilen können."
McLaughlan erklärt, dass es sich bei dem Begriff "KI-Psychose" zwar nicht um eine formale Diagnose handelt, er aber in letzter Zeit verwendet wurde, um Situationen zu beschreiben, in denen der Einsatz künstlicher Intelligenz den Sinn einer Person für das, was real ist und was generiert wurde, verwischt zu haben scheint.
Welche Anzeichen können darauf hinweisen, dass jemand an einer KI-Psychose leidet?
"Im Zusammenhang mit der so genannten KI-Psychose sind die Warnzeichen ähnlich wie bei jeder psychotischen Erkrankung, können aber durch das digitale Thema gefärbt sein", betont der Psychiater. "Angehörige könnten bemerken, dass sich die Person zunehmend mit Chatbots, Algorithmen oder Online-Plattformen beschäftigt. Sie könnten darauf bestehen, dass eine KI direkt mit ihnen kommuniziert, versteckte Nachrichten sendet oder sogar ihre Gedanken oder ihr Verhalten kontrolliert."
Weitere Warnsignale sind der Rückzug von Familie und Freunden, die Vernachlässigung der Selbstfürsorge, Schwierigkeiten bei der Arbeit oder beim Lernen oder ein ungewöhnliches Ausmaß an Angst, Misstrauen oder Reizbarkeit, fügt McLaughlan hinzu.
Was können die Folgen sein?
Die Folgen einer Psychose können, unabhängig davon, ob sie mit künstlicher Intelligenz in Verbindung steht oder nicht, sehr ernst sein, wenn sie unbehandelt bleibt.
 Credits: PA;
Credits: PA;
"In ihrem Kern verzerrt die Psychose die Realität. Das kann bedeuten, dass jemand Entscheidungen auf der Grundlage von Überzeugungen trifft, die nicht der Wahrheit entsprechen, z. B. wenn er glaubt, dass eine KI seine Finanzen, Beziehungen oder sogar seine Sicherheit steuert", sagt McLaughlan. "Dies kann sie dem Risiko eines finanziellen Schadens, sozialer Isolation oder Konflikten mit Familie und Kollegen aussetzen.
Es kann auch einen emotionalen Tribut fordern.
"Das Leben mit Halluzinationen oder dem Glauben, dass die eigenen Gedanken kontrolliert werden, ist beängstigend und anstrengend", sagt der Psychiater. "Ohne Hilfe können die Betroffenen zutiefst misstrauisch werden, sich aus dem Alltag zurückziehen oder sich in manchen Fällen sogar selbst in Gefahr bringen.
"In den schwersten Fällen ist eine unbehandelte Psychose mit Selbstverwahrlosung, Unfallverletzungen oder Suizidgefahr verbunden."
Wann sollte jemand professionelle Hilfe in Anspruch nehmen?
"Die wichtigste Botschaft für die Familien ist, diese Überzeugungen nicht als 'reine Technikbesessenheit' abzutun, sondern sie als mögliche Anzeichen für eine zugrunde liegende psychische Erkrankung zu erkennen", rät McLaughlan. "Eine frühzeitige Unterstützung durch einen Hausarzt oder eine psychiatrische Fachkraft kann einen großen Unterschied für die Genesung ausmachen.
Es gibt verschiedene Behandlungsmöglichkeiten für Psychosen, die helfen können.
"Die Behandlung umfasst in der Regel eine Kombination aus Medikamenten, psychologischer Therapie und praktischer Unterstützung", erklärt der Psychiater. "Die gebräuchlichsten Medikamente sind Antipsychotika, die die überaktive Dopamin-Signalgebung im Gehirn beruhigen und so Halluzinationen und Wahnvorstellungen reduzieren können.
McLaughlan betont jedoch, dass Medikamente nur ein Teil des Gesamtbildes sind.
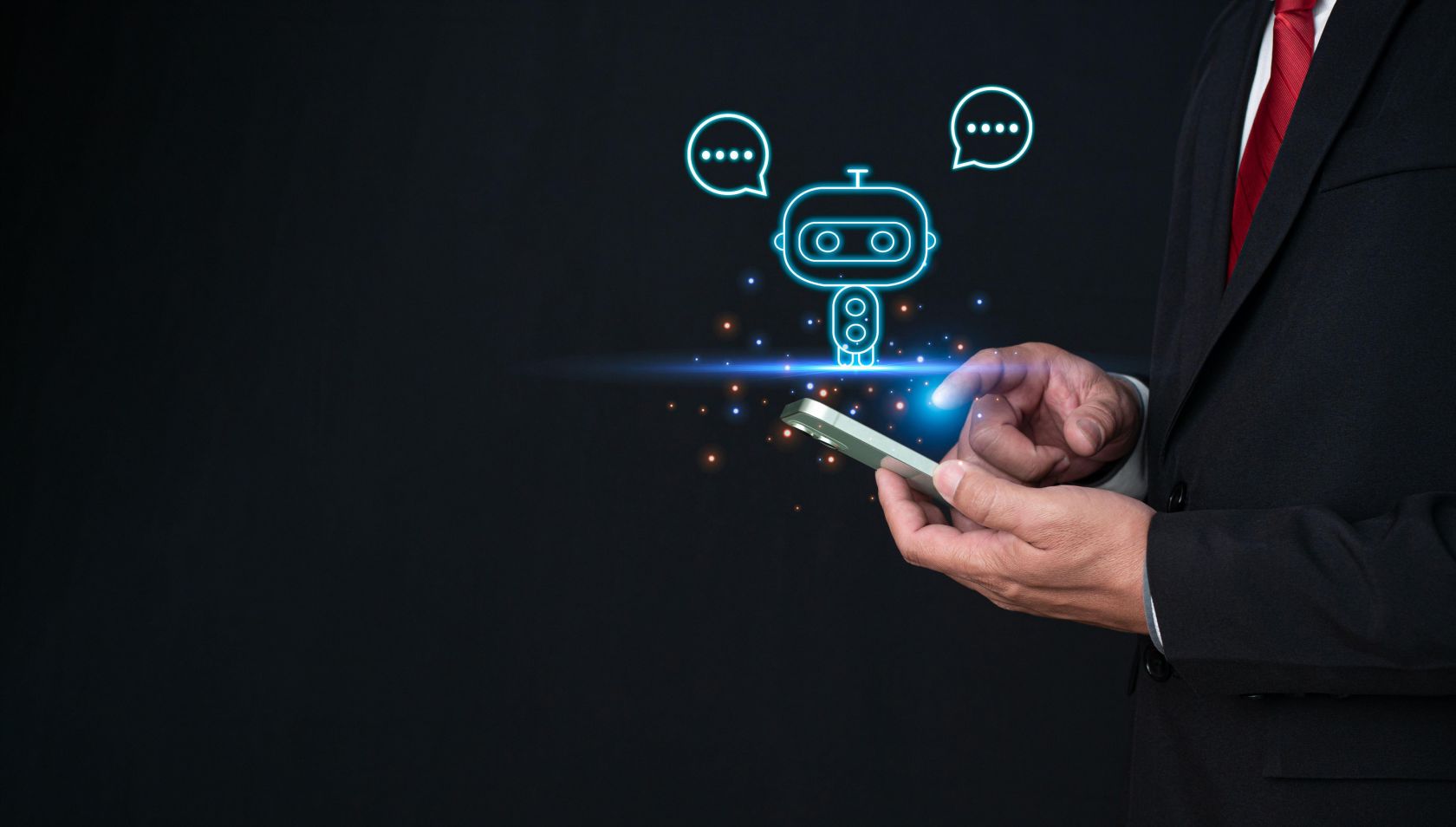 Credits: PA;
Credits: PA;
"Gesprächstherapien wie die kognitive Verhaltenstherapie bei Psychosen helfen den Betroffenen, beängstigende Gedanken zu überwinden und ungewöhnliche Erfahrungen zu verarbeiten", sagt McLaughlan. "Durch familiäre Interventionen können auch Angehörige in die Lage versetzt werden, die Genesung zu unterstützen und den Stress zu Hause zu reduzieren. Daneben ist die Unterstützung bei der Wohnungssuche, bei der Arbeit oder in der Ausbildung oft entscheidend, um den Betroffenen zu helfen, ihr Leben neu zu gestalten.
"Wir ermutigen die Menschen auch, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, also auf ausreichenden Schlaf, den Verzicht auf Drogen und Alkohol und die Bewältigung von Stress, da dies alles Rückfälle auslösen kann.
Kann man einen Rückfall verhindern?
"Wir können eine Psychose nicht immer ganz verhindern, da Faktoren wie Genetik und Gehirnchemie eine große Rolle spielen, aber wir können das Risiko verringern", sagt McLaughlan. "Bei der so genannten KI-Psychose geht es bei der Prävention oft darum, wie die Menschen mit der Technologie umgehen.
Ein gesundes Maß an digitaler Abgrenzung ist entscheidend.
"Begrenzen Sie die Zeit, die Sie mit Chatbots oder virtuellen Plattformen verbringen, und halten Sie ein Gleichgewicht mit Offline-Aktivitäten und sozialen Kontakten", rät der Psychiater.
Er betont, dass die wichtigste Botschaft darin besteht, dass ein frühzeitiges Eingreifen verhindern kann, dass sich ungewöhnliche Erfahrungen zu einer vollständigen Psychose auswachsen.
"Wenn jemand anfängt zu glauben, dass KI mit ihm kommuniziert oder ihn kontrolliert, ist es wichtig, schnell Hilfe zu suchen", betont McLaughlan. "Je früher wir eingreifen, desto besser sind die Heilungschancen und die Möglichkeit, eine längerfristige Erkrankung zu verhindern.